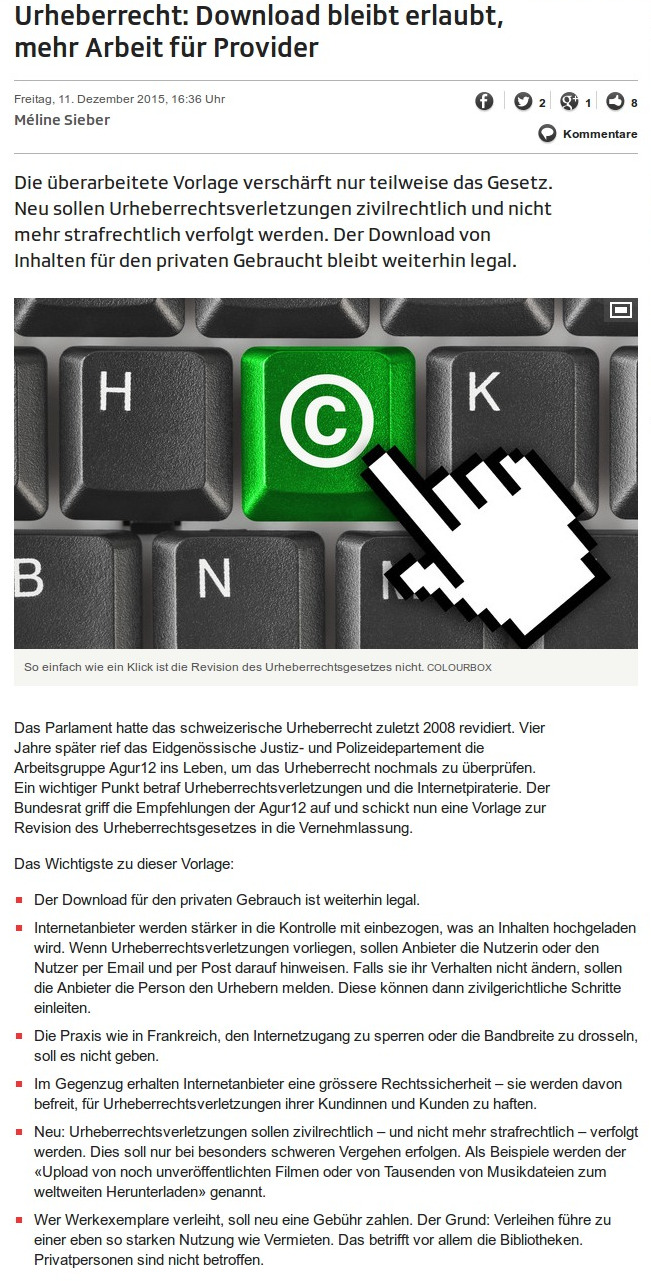Eine Vernehmlassung der Arbeitsgruppe zum Urheberrecht
plant auch in der Schweiz Netzsperren. Um Piraterie
einzudämmen, sollen auch in der Schweiz nun die Nutzer von ihren Providern
Blockaden vor die Nase gesetzt bekommen. Das heisst, dass gewisse Webseiten nicht
mehr erreichbar werden. In Deutschland wurden
Zugangserschwerungsgesetze
wieder ausserkraft gesetzt, nachdem man gemerkt hat, dass Sperren auch
Kollateralschäden verursachen können und die Informationsfreiheit
beschränken könnten.
Eine Vernehmlassung der Arbeitsgruppe zum Urheberrecht
plant auch in der Schweiz Netzsperren. Um Piraterie
einzudämmen, sollen auch in der Schweiz nun die Nutzer von ihren Providern
Blockaden vor die Nase gesetzt bekommen. Das heisst, dass gewisse Webseiten nicht
mehr erreichbar werden. In Deutschland wurden
Zugangserschwerungsgesetze
wieder ausserkraft gesetzt, nachdem man gemerkt hat, dass Sperren auch
Kollateralschäden verursachen können und die Informationsfreiheit
beschränken könnten. Die Zusammenfassung auf dem EJPD tönt harmlos:
Der Bundesrat will das Urheberrecht modernisieren. Unter anderem
soll Internet-Piraterie besser bekämpft werden, ohne dass dabei aber
die Nutzer solcher Angebote kriminalisiert werden. Gleichzeitig werden die
gesetzlichen Bestimmungen an die neusten technologischen Entwicklungen
angepasst. Die Vorlage zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes
(URG), die der Bundesrat am Freitag in die Vernehmlassung geschickt hat,
orientiert sich an den Empfehlungen der Arbeitsgruppe zum Urheberrecht
(AGUR12). Parallel zu dieser Vorlage wurden auch zwei Abkommen der
Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) in die Vernehmlassung
geschickt.
Schwerwiegend ist aber der folgende Vorschlag, der ganz klar Netzsperren
vorschlägt: | Schweizer Hosting Provider sollen keine Piraterieplattformen beherbergen und bei Urheberrechtsverletzungen über ihre Server die betreffenden Inhalte rasch entfernen. Grosse, kommerzielle Piratenseiten werden allerdings oft bei Hosting Providern beherbergt, deren Sitz oder Standort sich im Ausland befindet oder deren Standort verschleiert ist. In diesen Fällen sollen die Schweizer Access Provider auf Anweisung der Behörden den Zugang sperren. Die Internetsperren sind dabei so auszugestalten, dass die gleichzeitige Sperrung rechtmässiger Inhalte ("Overblocking") möglichst vermieden wird. |
Die Problematik wurde an verschiedenen Orten schon kritisiert, etwa auch in Deutschland. Zum Beispiel ist nach einer Blockade von der Öffentlichkeit nicht mehr einsehbar, ob die Sperrung auch rechtsmässig ist, denn man kann ja die entschrechenden Netze nicht mehr erreichen. Das Urheberrecht ist nicht der einzige Grund, um Webseiten zu sperren: Ein anderes Beispiel ist Pornographie oder die Abschottung der Spielbanken. Wie Rechtsanwalt Martin Steiger in Netzpolitik feststellt:
| Für diese Massnahme müsste in der Schweiz eine Zensurinfrastruktur mit Netzsperren aufgebaut werden. |
Das heisst konkret, dass eine Schwarze Liste von Webseiten aufgebaut wird, die vom User nicht mehr erreicht werden können. Der Bürger muss also darauf vertrauen, dass die Sperren rechtsmässig sind, und nicht zum Beispiel für politische Zwecke misbraucht werden, oder um einen Konkurrenten auszusperren. Um Zensur im Internet wird weltweit debattiert.
In Grossbritannien sollen auch harmlose Angebote im Filter hängenbleiben.
Ungefähr jede fünfte populäre Webseite wird von
Internet-Filtern blockiert, die in britischen Mobilfunk- und W-Lan-Netzen
installiert sind - das berichtet die Open Rights Group. Nach eigenen
Angaben haben die Digitalaktivisten die laut Statistikdienst Alexa.com
100.000 meistbesuchten Webseiten näher untersucht. Dabei stellten
sie fest, dass 19.000 dieser Seite durch die Filter mindestens eines
britischen Netzanbieters blockiert werden.
Unklar bleibt, was die Sperrung bestimmter Seiten veranlasst haben
könnte. Unter den blockierten Auftritten finden sich etwa die
Webpräsenz eines Porsche-Händlers, zwei feministische
Blogs, ein Blog über den syrischen Bürgerkrieg und das
Verschwörungs-Blog "Guido Fawkes".
In Österreich wurden Netzsperren vor kurzem eingeführt. Die Kosten für
die Sperren sollen
an den Kunden weitergegeben werden.
Auch in Deutschland (wo Netzsperren vor ein paar Jahren nur eine kurze Lebensdauer hatten),
sind
Netzsperren wieder geplant.
Interessant ist dass der Bericht von SRF die Empfehlungen in der Zusammenfassung auslässt. Die saure Apfel, die Netzsperren, wurde dabei ausgelassen, die auf der EJPD Seite erwähnt sind:
Aus SRF:
Die überarbeitete Vorlage verschärft nur teilweise das
Gesetz. Neu sollen Urheberrechtsverletzungen zivilrechtlich und nicht
mehr strafrechtlich verfolgt werden. Der Download von Inhalten für
den privaten Gebraucht bleibt weiterhin legal.
Das Parlament hatte das schweizerische Urheberrecht zuletzt 2008
revidiert. Vier Jahre später rief das Eidgenössische Justiz-
und Polizeidepartement die Arbeitsgruppe Agur12 ins Leben, um das
Urheberrecht nochmals zu überprüfen. Ein wichtiger Punkt betraf
Urheberrechtsverletzungen und die Internetpiraterie. Der Bundesrat griff
die Empfehlungen der Agur12 auf und schickt nun eine Vorlage zur Revision
des Urheberrechtsgesetzes in die Vernehmlassung.
Das Wichtigste zu dieser Vorlage:
Der Download für den privaten Gebrauch ist weiterhin legal.
Internetanbieter werden stärker in die Kontrolle mit einbezogen,
was an Inhalten hochgeladen wird. Wenn Urheberrechtsverletzungen
vorliegen, sollen Anbieter die Nutzerin oder den Nutzer per
Email und per Post darauf hinweisen. Falls sie ihr Verhalten
nicht ändern, sollen die Anbieter die Person den Urhebern
melden. Diese können dann zivilgerichtliche Schritte einleiten.
Die Praxis wie in Frankreich, den Internetzugang zu sperren oder
die Bandbreite zu drosseln, soll es nicht geben. Im Gegenzug
erhalten Internetanbieter eine grössere Rechtssicherheit -
sie werden davon befreit, für Urheberrechtsverletzungen ihrer
Kundinnen und Kunden zu haften. Neu: Urheberrechtsverletzungen sollen
zivilrechtlich - und nicht mehr strafrechtlich - verfolgt werden. Dies
soll nur bei besonders schweren Vergehen erfolgen. Als Beispiele
werden der "Upload von noch unveröffentlichten Filmen oder von
Tausenden von Musikdateien zum weltweiten Herunterladen" genannt.
Wer Werkexemplare verleiht, soll neu eine Gebühr zahlen. Der
Grund: Verleihen führe zu einer eben so starken Nutzung wie
Vermieten. Das betrifft vor allem die Bibliotheken. Privatpersonen
sind nicht betroffen.