 (SRF Quelle) |
Bei der Abstimmung zum Radio und Fernsehgesetz kam es zu einem Krimi.
Nur 3696 Stimmen haben schlussendlich entschieden und bewirkt,
dass die RTVG-Revision wurde knapp mit 50.08 Prozent angenommen
wurde. Der geplante Systemwechsel mit einer allgemeinen Beitrag ohne
geräteabhängige Gebühr wurde im Vorfeld der Abstimmung
mit harten Bandagen geführt.
Immer mehr verlagerte sich die Diskussion über den Systemwechsel.
Es wurde auch die Qualität des Service Public in Frage gestellt.
Die SRG war bei der Kampagne in einer heiklen Situation:
sie konnte die Medien nicht als Plattform benutzen. Auch das Verwenden
von SRG Geldern für eine Kampagne hätte kontraproduktiv sein
kjönnen.
Die Diskussion über den Service public wird nach der Abstimmung
sicher noch weitergeführt. Der Bevölkerung geht es um
die Qualität der Medien, Fragen der
Medienkritik, der Frage der Mitsprache der Zuhörer und Zuschauer
bei Unterhaltung, Sport etc, der Programmvielfalt oder der Transparenz.
Das Radio und Fernsehen hat hinsichtlich Informationssendungen eine
hohe Reputation. Die Macher haben einen Leistungsauftrag, dürfen
aber gemäss den Vorgaben die Programme selbst gestalten.
Man kann es nie allen recht machen. Die Erbsschaftssteuer hatte keine Chance. Viele fühlen sich bei Umverteilungsversuchen betroffen und möchten keine Experimente. 71 Prozent haben Nein gesagt. |
Eine Graphik aus
20 Min:
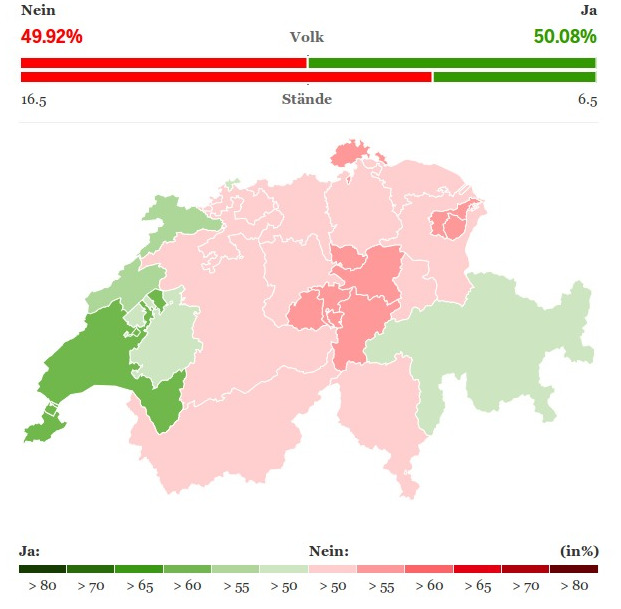
|
Nachtrag vom 15. Juni: 20Min
Als Misstrauensvotum interpretieren viele Beobachter das hauchdünne
Ja zur RTVG-Revision. Beide Lager stellen sich jetzt auf eine heisse
Service-public-Diskussion ein: Was ist der Leistungsauftrag der SRG und
wie viel darf sie kosten? Braucht es Korrekturen bei der Organisation?
Zwei Experten äussern sich pointiert zu fünf Streitpunkten.
"Die Information soll der
Hauptauftrag bleiben. Trotzdem muss die SRG eine vielfältige
Palette anbieten. Auch Sendungen wie "Glanz & Gloria" oder
Fussballübertragungen sollen Platz haben", sagt Kommunikationsexperte
Marcus Knill. Diskutiert werden müsse, ob die Kosten enorm teurer
Eigenproduktionen - etwa des "Bestatters" - verhältnismässig
sind. "Das Volk sollte allgemein mehr mitreden können. Auch sollten
Beschwerden des Publikums ernster genommen werden."
"Weltwoche"-Kolumnist Kurt W. Zimmermann sagt, dass sich das Programm an
den Bedürfnissen der Konsumenten orientieren sollte. "Die Leute
wollen Krimis und Unterhaltung - man sollte dies ernst nehmen. Es
wäre fatal, wenn man jetzt nur noch trockene Themen bringen
würde, die niemanden interessieren." Dass es ein Grundangebot in
allen Sprachregionen brauche, sei aber unbestritten.
Für Zimmermann ist die heutige
SRG zu teuer: "Das Fernsehen in der Deutschschweiz sollte nicht teurer
sein, als es heute in der Westschweiz ist. So könnte man schon
einmal 150 Millionen Franken einsparen - ohne dass der Konsument etwas
davon merkt." Laut Zimmermann braucht es auch nicht 17 Radio-Sender und 7
TV-Sender: "Jene Angebote, die nur einen marginalen Marktanteil von unter
sechs Prozent haben, sind überflüssig. Dazu zählt auch
Radio SRF 2. Wozu soll man etwas produzieren, was gar kein Publikum hat?"
Auch Knill empfiehlt, auf die Kostenbremse zu treten: "Die Leute haben
Angst, dass die Gebühren künftig ansteigen - das hat man im
Abstimmungskampf deutlich gesehen. Man sollte die Einnahmen aus den
Abgaben einfrieren und ein Kostendach für die SRG definieren,
welches nicht überschritten werden darf." Solange die Sender
innerhalb des Kostendachs zu finanzieren seien, müssten sie nicht
geschlossen werden.
"Das Erstaunliche am
Abstimmungskampf war, dass man aus dem Mund von Roger De Weck
nur gehört hat, dass bei der SRG alles picobello ist. Ganz
nach dem Motto: Ausser uns ist nur der Herrgott vollkommen", sagt
Zimmermann. Normal wäre gewesen, dass man auch Fehler eingestehe
und Besserung gelobe. "Eine solche Fähigkeit zur Selbstkritik
wäre wünschenswert."
Knill träumt ebenfalls von mehr Bürgernähe: "Den Dialog
mit dem Volk gilt es zu intensivieren." Die SRG dürfe nicht
zum Selbstdarstellungsinstitut verkommen, in dem sich die Kollegen
ständig gegenseitig in Sendungen einlüden.
Bei der Organisation hat Zimmermann
einen radikalen Reformvorschlag: "Da die SRG jetzt über eine
Abgabe finanziert wird, kann man sie in ein Bundesamt für Funk (BFF)
umwandeln. Ihr Budget müsste jedes Jahr bewilligt werden." Zimmermann
verspricht sich davon eine echte Diskussion über die Kosten. "Die
SRG müsste bei den Sparprogrammen bluten, wie es die Armee in den
letzten Jahren getan hat."
"Wichtig ist vor allem, dass Strukturen geschaffen werden, die mehr
Transparenz garantieren - sowohl beim Programm als auch bei den Finanzen",
sagt Knill. "Hätte Roger De Weck seinen Lohn offengelegt, wäre
sein Salär nicht so lange thematisiert worden."
Die beiden Experten sind sich einig,
dass es ohne TV-Werbung nicht geht: "Als Konsument ärgert es
mich aber, wenn ein Krimi unterbrochen wird. Ich möchte keine
amerikanischen Verhältnisse. Man sollte sich auf Werbeblocks zwischen
den Beiträgen konzentrieren."
Laut Zimmermann ist ein Kanal, mit dem man die breite Masse erreicht,
im Interesse der Wirtschaft. "Man könnte sich jedoch überlegen,
das Programm abends ab einer gewissen Uhrzeit werbefrei zu machen."

Das neue Gesetz tritt 2016 in Kraft. Der Wechsel des Gebührensystems
erfolgt frühestens 2018/2019, weil der Bund Zeit braucht für
die administrative Umsetzung. Der Bundesrat wird den Inkassoauftrag,
den derzeit die Billag AG wahrnimmt, neu ausschreiben.
Eine Haushaltsabgabe wird voraussichtlich 2018 oder 2019 die Gebühr
auf Empfangsgeräte ersetzen. Für Haushalte sinkt dann die
Gebühr von 451 auf unter 400 Franken. Drei Viertel der Firmen
sind von der Gebühr befreit, weitere neun Prozent zahlen weniger
als heute. Der Anteil privater Sender an den Gebühreneinnahmen
wird steigen. 34 Lokalsender erhalten zusätzliches Geld für
Investitionen in die digitale Verbreitung und die Ausbildung ihrer
Redaktionen.
Während einer fünf Jahre dauernden Übergangsfrist
können sich Medienabstinente von der Gebühr befreien
lassen. Dauerhaft befreit sind alle Bewohnerinnen und Bewohner von Alters-
und Pflegeheimen.
Weil es keine Schwarzseherinnen und Schwarzhörer mehr gibt, wird
die Gebühr sinken - nach Angaben des Bundesrates auf rund 400
Franken. Dies dürfte der Grund dafür sein, dass das Volk am
Ende doch Ja gesagt hat.
(...)
Die Diskussionen über die Radio- und Fernsehgebühren sind mit
dem Ja von Sonntag nicht zu Ende. SRG-Kritiker sammeln Unterschriften
für eine Volksinitiative zur Abschaffung der Gebühren. Eine
erste Initiative mit diesem Anliegen war nicht zustande gekommen.
Zudem endet 2017 der zehnjährige Leistungsauftrag der SRG: Der
Bundesrat wird den Entwurf einer neuen SRG-Konzession veröffentlichen
und in einer Anhörung zur Diskussion stellen.
Weitergehen wird auch die Diskussion über die Frage, wie viel
Service public es braucht und was darunter fällt. Heute haben Radio
und Fernsehen laut der Bundesverfassung den Auftrag, zur Bildung und
kulturellen Entfaltung, zur freien Meinungsbildung und zur Unterhaltung
beizutragen. Sie sollen die Ereignisse sachgerecht darstellen und die
Vielfalt der Ansichten angemessen zum Ausdruck bringen.
