
Wer Kinder hat, weiss, dass sie ihre SMS in Mundart verfassen. Schreibt
man nun auf Hochdeutsch oder Mundart zurück? Die Frage ist von
tiefgreifender Bedeutung für den Gebrauch der Mundart, der sich
bisher auf Mündlichkeit beschränkte. Es ist eine linguistische
Revolution im Gange, deren Ende weit offen ist.
Auf Facebook gibt es eine Seite, sie heisst "Schwyzerdütsch" und
zählt über 270 000 Follower. Zum Vergleich: Analoge Seiten
für die "Deutsche Sprache" bringen es zusammen auf etwa 85 000 Fans,
und sogar die internationale "English Language"-Community auf Facebook ist
kleiner. Auf der Schwyzerdütsch-Seite tauscht man sich, wie in jedem
sozialen Netz, über alles Mögliche aus, mit Vorliebe über
"heimische" Themen und sehr viel - über Dialektwörter. Man fragt
zum Beispiel, ob jemand wisse, was "pfägsä" heisse; es laufen
Sammelaktionen für Dialektausdrücke, so wie etwa für die
"Pfütze": Glungge, Guntä, Glonge, Gudlä, Gumpi, Guddla -
zum Wort sind 1400 "Kommentär" eingegangen. Doch die Facebook-Seite
ist nicht nur als Volks-Idiotikon interessant. Und sie ist auch nicht
nur Zeugnis des markanten Interesses, das viele Schweizer heute an ihrer
Mundart haben. Die Seite gibt auch Einblick in die spannende Entwicklung,
die Schweizerdeutsch zurzeit durchmacht. Es ist eine Entwicklung, die
den linguistischen Wissensstand über Schweizerdialekte in vielen
Aspekten überholt hat. Die neue Handy-Generation
Das Erste, was nicht mehr zutrifft: dass Schweizerdeutsch eine
mündliche Sprachvarietät ist, in der nur "gelegentlich"
geschrieben wird. Die altersdurchmischte, zum grössten Teil jedoch
aus jüngeren Leuten bestehende Schwyzerdütsch-Gemeinschaft
kommuniziert auf Facebook eben auf Mundart. Das wäre gar nicht
möglich gewesen, wenn sich diese im letzten Jahrzehnt nicht zu
einer etablierten Schriftsprache entwickelt hätte.
Dies hat mit dem Phänomen der neuen Schriftlichkeit zu tun, das
weltweit im Zusammenhang mit der Entwicklung der elektronischen Medien
zu beobachten ist. Denn wir Handy-, Smartphone- und Computerbesitzer
schreiben heute unvergleichlich öfter und oft auch anders als
vor zwanzig Jahren. In den meisten Sprachen wirkt sich dies auf die
eine oder andere Weise aus. In der Schweiz hat diese Entwicklung eine
unerwartete Folge: die Verschriftlichung der Mundart. Bei einem Teil der
Bevölkerung, zumal bei Kindern und Jugendlichen, ist mittlerweile
eine schriftliche Parallel-Sprache entstanden. Bei den Jungen läuft
der private schriftliche Austausch - per SMS, Chat, Mail, Postkarte -
fast ausschliesslich in der Mundart ab. Die Gründe dafür sind
vielfältig: Schriftdialekt bedient die neue allgemeine Tendenz zur
Informalität, es schreibt sich, vor allem in der "dialogischen"
Kommunikation, leichter, spontaner und authentischer. Es gibt hier keine
Klassenschranken.
(...)
Wie geht es nun weiter mit Mundart und Hochdeutsch? Wie pegeln sich all
diese Entwicklungen ein und aus? Dem heimatbeschwörenden Kult der
Mundart steht eine vermehrte öffentliche Präsenz von Hochdeutsch
durch Einwanderung gegenüber. Wer wird sich hier wem anpassen? Die
Zukunft wird es zeigen. Schriftdialekt wiederum wird von immer mehr
Schweizern geschrieben werden. Wie lange noch antworten die Eltern auf
die Dialekt-SMS ihrer Kinder auf Hochdeutsch? Es könnte sein, dass
in absehbarer Zeit Zweischriftigkeit in der Schweiz allgemein wird. Dass
der Schriftdialekt nicht mehr nur für das Private reserviert bleibt,
sondern auch ins Öffentliche einsickert und irgendwann die Weihen
des Offiziellen erhält.
So wie es im Laufe der Geschichte mit verschiedenen Dialekten
passiert ist, wie etwa in Luxemburg. 1984 wurde dort das einheimische
Lëtzebuergesch, eine Gruppe von moselfränkischen Dialekten,
zur Nationalsprache ernannt. Seither fungiert es neben Hochdeutsch und
Französisch als "offizielle", auch schriftliche Sprache. Für
Lëtzebuergesch wurde eine Grammatik verfasst, es ist teilweise
im Schulunterricht zugelassen. Staatsbeamte sind verpflichtet, die
Briefe der Bürger in der Sprache zu beantworten, in der sie diese
bekommen. In den Zeitungen findet man, neben Artikeln auf Französisch
und Hochdeutsch, meist auch einige auf Lëtzebuergesch. Selbst
auf Wikipedia ist die Sprache zu finden, wo man etwa lesen kann:
"D'Schwäiz ass e Staat a Mëtteleuropa. D'Land grenzt am Norden
un Däitschland, am Osten u Liechtenstein an Éisträich,
am Süden un Italien an am Westen u Frankräich." Womöglich
ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir ebenda einen Artikel über
Luxemburg uf Schwyzerdütsch läse chönd.
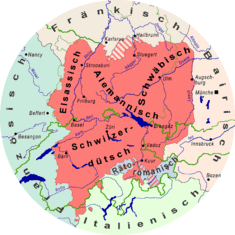
 Wer Kinder hat, weiss, dass sie ihre SMS in Mundart verfassen. Schreibt
man nun auf Hochdeutsch oder Mundart zurück? Die Frage ist von
tiefgreifender Bedeutung für den Gebrauch der Mundart, der sich
bisher auf Mündlichkeit beschränkte. Es ist eine linguistische
Revolution im Gange, deren Ende weit offen ist.
Auf Facebook gibt es eine Seite, sie heisst "Schwyzerdütsch" und
zählt über 270 000 Follower. Zum Vergleich: Analoge Seiten
für die "Deutsche Sprache" bringen es zusammen auf etwa 85 000 Fans,
und sogar die internationale "English Language"-Community auf Facebook ist
kleiner. Auf der Schwyzerdütsch-Seite tauscht man sich, wie in jedem
sozialen Netz, über alles Mögliche aus, mit Vorliebe über
"heimische" Themen und sehr viel - über Dialektwörter. Man fragt
zum Beispiel, ob jemand wisse, was "pfägsä" heisse; es laufen
Sammelaktionen für Dialektausdrücke, so wie etwa für die
"Pfütze": Glungge, Guntä, Glonge, Gudlä, Gumpi, Guddla -
zum Wort sind 1400 "Kommentär" eingegangen. Doch die Facebook-Seite
ist nicht nur als Volks-Idiotikon interessant. Und sie ist auch nicht
nur Zeugnis des markanten Interesses, das viele Schweizer heute an ihrer
Mundart haben. Die Seite gibt auch Einblick in die spannende Entwicklung,
die Schweizerdeutsch zurzeit durchmacht. Es ist eine Entwicklung, die
den linguistischen Wissensstand über Schweizerdialekte in vielen
Aspekten überholt hat. Die neue Handy-Generation
Das Erste, was nicht mehr zutrifft: dass Schweizerdeutsch eine
mündliche Sprachvarietät ist, in der nur "gelegentlich"
geschrieben wird. Die altersdurchmischte, zum grössten Teil jedoch
aus jüngeren Leuten bestehende Schwyzerdütsch-Gemeinschaft
kommuniziert auf Facebook eben auf Mundart. Das wäre gar nicht
möglich gewesen, wenn sich diese im letzten Jahrzehnt nicht zu
einer etablierten Schriftsprache entwickelt hätte.
Dies hat mit dem Phänomen der neuen Schriftlichkeit zu tun, das
weltweit im Zusammenhang mit der Entwicklung der elektronischen Medien
zu beobachten ist. Denn wir Handy-, Smartphone- und Computerbesitzer
schreiben heute unvergleichlich öfter und oft auch anders als
vor zwanzig Jahren. In den meisten Sprachen wirkt sich dies auf die
eine oder andere Weise aus. In der Schweiz hat diese Entwicklung eine
unerwartete Folge: die Verschriftlichung der Mundart. Bei einem Teil der
Bevölkerung, zumal bei Kindern und Jugendlichen, ist mittlerweile
eine schriftliche Parallel-Sprache entstanden. Bei den Jungen läuft
der private schriftliche Austausch - per SMS, Chat, Mail, Postkarte -
fast ausschliesslich in der Mundart ab. Die Gründe dafür sind
vielfältig: Schriftdialekt bedient die neue allgemeine Tendenz zur
Informalität, es schreibt sich, vor allem in der "dialogischen"
Kommunikation, leichter, spontaner und authentischer. Es gibt hier keine
Klassenschranken.
(...)
Wer Kinder hat, weiss, dass sie ihre SMS in Mundart verfassen. Schreibt
man nun auf Hochdeutsch oder Mundart zurück? Die Frage ist von
tiefgreifender Bedeutung für den Gebrauch der Mundart, der sich
bisher auf Mündlichkeit beschränkte. Es ist eine linguistische
Revolution im Gange, deren Ende weit offen ist.
Auf Facebook gibt es eine Seite, sie heisst "Schwyzerdütsch" und
zählt über 270 000 Follower. Zum Vergleich: Analoge Seiten
für die "Deutsche Sprache" bringen es zusammen auf etwa 85 000 Fans,
und sogar die internationale "English Language"-Community auf Facebook ist
kleiner. Auf der Schwyzerdütsch-Seite tauscht man sich, wie in jedem
sozialen Netz, über alles Mögliche aus, mit Vorliebe über
"heimische" Themen und sehr viel - über Dialektwörter. Man fragt
zum Beispiel, ob jemand wisse, was "pfägsä" heisse; es laufen
Sammelaktionen für Dialektausdrücke, so wie etwa für die
"Pfütze": Glungge, Guntä, Glonge, Gudlä, Gumpi, Guddla -
zum Wort sind 1400 "Kommentär" eingegangen. Doch die Facebook-Seite
ist nicht nur als Volks-Idiotikon interessant. Und sie ist auch nicht
nur Zeugnis des markanten Interesses, das viele Schweizer heute an ihrer
Mundart haben. Die Seite gibt auch Einblick in die spannende Entwicklung,
die Schweizerdeutsch zurzeit durchmacht. Es ist eine Entwicklung, die
den linguistischen Wissensstand über Schweizerdialekte in vielen
Aspekten überholt hat. Die neue Handy-Generation
Das Erste, was nicht mehr zutrifft: dass Schweizerdeutsch eine
mündliche Sprachvarietät ist, in der nur "gelegentlich"
geschrieben wird. Die altersdurchmischte, zum grössten Teil jedoch
aus jüngeren Leuten bestehende Schwyzerdütsch-Gemeinschaft
kommuniziert auf Facebook eben auf Mundart. Das wäre gar nicht
möglich gewesen, wenn sich diese im letzten Jahrzehnt nicht zu
einer etablierten Schriftsprache entwickelt hätte.
Dies hat mit dem Phänomen der neuen Schriftlichkeit zu tun, das
weltweit im Zusammenhang mit der Entwicklung der elektronischen Medien
zu beobachten ist. Denn wir Handy-, Smartphone- und Computerbesitzer
schreiben heute unvergleichlich öfter und oft auch anders als
vor zwanzig Jahren. In den meisten Sprachen wirkt sich dies auf die
eine oder andere Weise aus. In der Schweiz hat diese Entwicklung eine
unerwartete Folge: die Verschriftlichung der Mundart. Bei einem Teil der
Bevölkerung, zumal bei Kindern und Jugendlichen, ist mittlerweile
eine schriftliche Parallel-Sprache entstanden. Bei den Jungen läuft
der private schriftliche Austausch - per SMS, Chat, Mail, Postkarte -
fast ausschliesslich in der Mundart ab. Die Gründe dafür sind
vielfältig: Schriftdialekt bedient die neue allgemeine Tendenz zur
Informalität, es schreibt sich, vor allem in der "dialogischen"
Kommunikation, leichter, spontaner und authentischer. Es gibt hier keine
Klassenschranken.
(...)